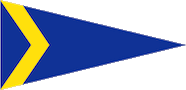Die Stella ist eine inzwischen 47 Jahre alte Stahlslup, die auf einer
holländischen Werft gebaut wurde. Deck und Kajüte sind aus Holz. Sie ist knapp 10 m
lang, 2,5 m breit, hat einen Tiefgang von gut 1,9 m und wir glauben, daß sie
inzwischen voll ausgerüstet etwa 8 Tonnen wiegt.
Was zuvor geschah: Nach einer Atlantik-Passage Ende 2000 , Segeln in der
Karibik und an der Ost-Küste der USA nach Maine und zurück (Sommer 2001),via
Bahamas und Jamaica nach Panama. Anfang April 2002 Passage des Panama-Kanals und
und Querung des Pazifik bis Anfang November Ankunft in Brisbane
(Australien). Fuer die letzten Inselstaaten (Samoa, Tonga Fiji, Vanuatu und Neukaledonien
hatten wir nur noch wenig Zeit. Daher beschlossen wir, unseren Gesamttoern
um ein Jahr zu verlaengern und nochmals in den westlichen Teil des Pazifik
zurueckzukehren. Über die letzten 12 Monate soll jetzt berichtet werden.
Nach einem Heimaturlaub in Kiel im Dezember 2002 / Januar 2003 flogen wir
ueber Singapore (einige Tage stopover) zunaechst fuer 6 Wochen nach Neuseeland.
Mit einem Mietauto erkundeten wir die Sued- und die Nordinsel.
Neuseeland ist fuer Naturliebhaber ein wunderbares Reiseland. Wir
uebernachteten in sogenannten Backpackerhotels oder Jugendherbergen, die alle
Doppelzimmer zur Verfuegung hatten. Man bekam viele Kontakte zu den anderen, meist
jugendlichen Reisenden, erhielt viele Tipps und hatte auch Spass miteinander.
Zurueck in Australien kauften wir uns ein Auto, weil inzwischen die
Entscheidung gefallen war, den Aufenthalt um ein Jahr zu verlängern. Zunaechst
leisteten wir uns weitere 11 Tage Urlaub und fuhren mit dem Auto nach Sidney (Hin-
und zurück mit Abstechern ca 3.000 km). Wir erhielten einen ersten Eindruck
von der Grösse Australiens.
Nach unserer Rückkehr verholten wir die Stella für 2 Wochen in eine Werft,
um notwendige Überholungsarbeiten durchzuführen (Korrosionsschutz am
Unterwasserschiff, neues Antifouling, Mast gezogen und vollstaendig abgezogen und neu
lackiert, Spieren und Kajüte neu lackiert). Nach Rückkehr in das Wasser war
noch eine lange Arbeitsliste abzuarbeiten u.a. Korrosionsschutz im Schiff und
an den Relingsstuetzen, Anker zur Verzinkung bringen, Rettungsinsel warten
lassen, Segel beim Segelmacher überholen lassen und viele weitere Punkte.
Natuerlich kam auch das Vergnügen nicht zu kurz. Manche Abende verbrachten
wir bei Bier, australischem Rotwein oder Sekt mit alten und neuen Freunden.
Mitte Mai kam Hubert aus Kiel zu uns, der ursprünglich vor hatte, mit uns
nach Samoa zu segeln ( nach seiner Rechnung kein Problem, da nur 2.500 sm zu
segeln waren und ihm etwa 35 Tage zur Verfügung standen. Bedauerlicherweise
davon der grösste Teil hoch am Wind.
Unser Ziel war zunächst Tonga (ca 2.000 sm östlich von Brisbane), das bei
dem vorherrschenden Südostpassat schwierig zu erreichen ist. Die Ueberfahrt
verlief jedoch etwas anders als geplant. Zunaechst wollten wir etwas nach Sueden
laufen, um in die guenstige Westwinddrift zu gelangen. Auf dem Weg dorthin
hatten wir viel Flaute und verbrauchten einen grossen Teil unseres Dieseloels.
Dann traf uns eine Front mit viel Wind (15 Stunden beigedreht). Das
anschliessende Segelvergnuegen waehrte nicht lange, da wir mitten in ein ausgedehntes
Hoch hineingerieten, in dem wir fast drei Tage nahezu bewegungslos
herumtrieben. Der Diesel reichte nicht mehr, um aus dem Hoch herauszufahren, wie uns
die regelmaessig empfangenen Wetterkarten zeigten. Die Zeit lief dem armen
Hubert davon, der seinen Flieger erreichen musste, um rechtzeitig im Dienst zu
sein. Als wir endlich den erhofften Westwind bekamen, zeigten die Wetterkarten
in Richtung Tonga wieder einen grossen Hochdruckguertel. Es war klar, dass
wir selbst Tonga (von Samoa ganz zu schweigen) nicht rechtzeitig erreichen
konnten. Wir liefen, kurz entschlossen, Whangarei in Neuseeland an. Hubert
verliess uns hier.
Wir verbrachten 10 kuehle Tage im neuseelaendischen Winter. Tags war es
mittags etwa 18° bis 20° warm, abends, nachts und morgens war es aber empfindlich
kuehl (morgens in der Kajuete nur 11°). Da wir in Whangarei in einer Marina
mit Stromanschluss lagen, kauften wir flugs einen elektrischen Heizofen und
hatten es gemuetlich warm.Wir versorgten das Schiff und pflegten das
gesellschaftliche Leben.
In Whangarei gibt es einen sehr aktiven TO Stuetzpunktleiter und am Hafen
eine Kneipe, die jeden Dienstag abends fuer eine Stunde das Bier zum halben
Preis verkauft. Hier treffen sich alle Segler, Informationen werden ausgetauscht
(wo gibt es wann Vollkornbrot, u.a.) und Verabredungen werden getroffen.
Nach acht Tagen versuchten wir auszulaufen, hatten jedoch ein kleines Tief
unterschaetzt. Kaum waren wir aus der schuetzendes Flussmuendung heraus, wehte
es heftig und eine beachtliche See traf uns. Nach kurzer Zeit war ich das
erste mal auf unserer dreijaehrigen Reise sterbens seekrank. Beidrehen brachte
mir gar nichts, so bettelte ich Wolfgang an, eine geschuetzte Ankerbucht
hinter einer der vorgelagerten Inseln anzulaufen, aber da gab es nichts
Brauchbares. Wolfgang wendete, wir segelten zurueck, auf dem Vor-dem-Wind-Kurs ging es
mir bald wieder gut und bei letztem Tageslicht erreichten wir eine
geschuetzte Ankerbucht. Am naechsten Morgen wehte es immer noch, so kehrten wir nach
Whangarei zurueck. Drei Tage spaeter liefen wir erneut, diesmal zusammen mit
drei weiteren Yachten aus. Darunter war auch die deutsche Yacht Joeke, die wir
bereits von Mogan auf den Kanaren kennen.
Die Reise nach Tonga verlief abwechslungsreich. Zunaechst einen Tag
angenehmste Segelei, dann fuenf Tage mehr oder weniger durch ein Hoch motoren. Dann
kam Wind. Drei Tage wehte es mit etwa 7 bis 8 Bft schraeg von achtern. Wir
erreichten die Riffdurchfahrt, die uns in das Fahrwasser nach Nuko a’lofa, der
Haupstadt von Tonga brachte, zwei Stunden nach Einbruch der Dunkelheit. Wir
hatten keine Lust, bei dem ruppigen Wetter noch eine Nacht beigedreht draussen
zu verbringen. Wolfgang studierte unser Kartenmaterial (Papier- und
elektronische Karten) und verglich die Positionen mit dem Radarbild, auf dem sich die
Riffeinfahrt deutlich abzeichnete (die Brandung auf dem Riff zeichnete auf
dem Radarschirm deutliche Echos). Diese Karten schienen die richtige Position
des Riffs wiederzugeben. (Die Karten waren im zweiten Weltkrieg von den
Armerikanern, die hier einen Stuetzpunkt hatten, neu erstellt worden.) Wir wagten
die Riffdurchfahrt und ankerten nach einer halben Stunde in ruhigem Wasser
hinter dem Riff. Die Weiterfahrt ist bei Dunkelheit nicht moeglich, weil nur
bei Tageslicht die im und neben dem Fahrwasser befindlichen Korallenkoepfe und
Riffe erkannt werden koennen.
Am naechsten Tag verholten wir in den Hafen, klarierten mit Hilfe von Paul,
dem TO-Stuetzpunktleiter ein zusammen mit Joeke, die auch angekommen war, und
verbrachten einige nette Tage im Hafen. Hier lernten wir auch Winfried
kennen, einen deutschen Segler, der taeglich viel Zeit darauf verwendet,
verschiedene Wetterinformationen auszuwerten und in einer Funkrunde auf Kurzwelle, die
deutschsprachigen Segler zu beraten. Winfried organisiert in dieser
Funkrunde auch Hilfeleistungen fuer in Not befindliche Segler (z.B. hatte sich ein
deutscher Segler bei hartem Wetter eine Augenverletzung zugezogen. Naechster
Hafen war Port Vila (Vanuatu), wohin noch ca drei Tage zu segeln war.Von
Seglern vor Ort wurden alle Massnahmen fuer die Zeit nach der Ankunft getroffen.
Der oertliche Arzt nahm eine Notversorgung vor und dann ging es ab in den
Flieger nach Sidney in eine Augenklinik. Zum Glueck war das Auge selbst nicht
verletzt.
Wir blieben bis zum Geburtstag des Koenigs, der mit allerlei oeffentlichen
Veranstaltungen gefeiert wurde und verliessen am 5. Juli 2003 Nuku a’lofa
Richtung Samoa. Die ca 500 sm lange Ueberfahrt verlief problemlos, wir kamen
rechtzeitig an, um Volker fuer sechs Wochen an Bord zu nehmen. Apia kannten wir
aus dem Vorjahr, diesmal hatten wir aber Gelegenheit, in einem Hotel eine Show
mit pazifischen Taenzen und Gesaengen sowie zum Abschluss mit Feuertaensen
anzusehen. Besonders der Teil mit den Feuertaenzen war beeindruckend.
Mit Volker segelten wir auf die Nachbarinsel Savaii, die groesser als Opulu
ist, aber deutlich weniger entwickelt. Wir machten eine Autorundfahrt um die
Insel und besuchten mitten im tropischen Regenwald eine alte Kultplattform.
Diese besteht aus einem etwa 11 m hoch aufgeschichteten Pyramidenstumpf, der
an der Basis eine Kantenlaenge von 40 x 60 m hat. Die Bedeutung ist nicht mehr
bekannt. Volker hatte auch noch Gelegenheit, bei einer von drei Deutschen
betriebenen Tauchschule einen Tag zu tauchen. Dann ging es weiter nach Fiji.
Der ca 600 sm lange Toern verlief zunaechst ganz gemuetlich, dann wurde der
Passat aber mal wieder von einer Front aus dem Suedmeer gestoert und wir mussten
die letzten 50 smbei 6 Bft kreuzen (das hatten wir schon lange nicht mehr
getan).
Wir klarierten in Suva ein, das wir aus dem Vorjahr kannten. Es war -wie im
Vorjahr – verregnet, der Segelclub, vor dem man ankert, hat eine leidlich
brauchbare Dusche, eine Waschmaschine und eine nette Bar. Nach einer Woche
Versorgung (Volker lud aktuelle Programme fuer mich aus dem Internet und brachte
meinen Computer auf Vordermann), begannen wir, in die Inselwelt von Fiji zu
segeln.
Ziel war zunaechst die Inselgruppe um Beqa mitten in einem grossen
Riffgebiet ca 30 sm SW von Suva. Hier ankerten wir vor einem Dorf und besuchten den
Chief, um unser Gastgeschenk zu ueberbringen.
Dies erfordert nun wohl einige Erklaerungen:
In Fiji gehoert alles Land in der Regel einer der jeweils ansaessigen
Grossfamilien (Clans). Will man an Land, so ist es ueblich, zuerst dem Chief (oder
Tui) einen Besuch abzustatten und ein Gastgeschenk zu ueberreichen. Naehert
man sich dem Dorf und bleibt zoegernd stehen, wird man von einer Frau oder
einem Mann angesprochen, von dem man zum Chief gefuehrt wird. Unterwegs fragt
diese Person nach Namen, Schiffsnamen,und Herkunftsland. Vor dem Chief setzt
man sich auf den Boden (natuerlich barfuss), ohne dem Chief die Fusssohlen zu
zeigen. Der Begleiter erzaehlt dem Chief die erfragten Einzelheiten. Man
selbst darf zunaechst nicht selbst setzt man sich auf den Boden, ohne dem Chief
die Fußsohlen zu zeigen mit dem Chief reden, es sei denn, er fordert einen
selbst dazu auf. Das Gastgeschenk wird vor dem Chief auf den Boden gelegt, damit
er die Moeglichkeit hat, die Annahme zu verweigern. Nimmt er das Gastgeschenk
an, folgt ein Singsang mit Haendeklatschen, in dem fuer die Gaeste und alle
ihre Verwandten zu Hause der Segen der Goetter erbeten wird . Gelegentlich
folgt eine Kawa-Zeremonie. Nach Annahme des Gastgeschenks steht der Gast, sein
Boot und die Mannschaft unter dem Schutz des Clans.
Nun, welcher Art sind die Gastgeschenke? Ueblich ist mindestens ein
groesseres Bund von getrockenen Kawawurzeln (wir hatten uns mit 500 gr- Buendeln – zu
etwa 5 EUR – in Suva eingedeckt). Die Wurzeln werden fuer eine Kawa-Zeremonie
klein geschnitzelt, dann in kaltes Wasser gegeben und ordentlich
durchgedrueckt und gewrungen. Danach gibt es Kawa aus dem grossen Topf, einer nach dem
andern erhaelt einen Schluck aus einer halben Cocosnussschale. Das Zeug hat
eine leicht betaeubende Wirkung auf Lippen und Zunge, groessere Mengen sollen
muede machen und am naechsten Tag einen Kater verursachen. Es sieht wie eine
lehmige Bruehe aus und schmeckt auch so aehnlich.
Ein langer Toern brachte uns von hier zu der nordwestlichsten Inselgruppe
von Fiji, zu den Yasawas. Von Nord nach Sued besuchten wir einige schoene
Buchten, besuchten Chiefs (mit Kawa) schnorchelten (Volker tauchte) und machten
einen Ausflug zu einem großen Hoehlensystem, in dem auch geschwommen werden
konnte. Leider waren hier wie auch in einer der anderen Buchten viele Seelaeuse,
die beim Baden bissen. Die Hoehle enthaelt einige Steinritzungen, die es in
aehnlicher Weise an weiteren Orten gibt, deren Bedeutung aber nicht mehr
bekannt ist.
Wir fuhren (mangels Wind unter Motor) zu der naechst suedlicheren
Inselgruppe, den Mamanuthas). In einer Marina, richtig am Steg, mit warmer Dusche und
Bars mit leckeren Drinks liessen wir es uns hier gut gehen und genossen mal
wieder die Zivilisation
Volkers Zeit an Bord ging zu Ende. Wir verholten in eine Marina, die dicht
am Flughafen liegt und begannen, an der Stella wieder zu arbeiten, da eine
Front uns 10 Tgae mit SW-Winden in der Marina festhielt, denn unser neues Ziel
(Tanna ,Vanuatu) lag ca 450 sm suedwestlich von uns.
Auf unserem Weg in die Hauptstadt von Vanuatu legten wir in Tanna einen
Zwischenstopp ein, weil es hier einen leicht zugaenglichen aktiven Vulkan gibt.
Am spaeten Nachmittag brachte ein Pickup uns und einige andere Segler einer
1-stuendigen Fahrt ueber gebirgige Wege zum Kraterrand. Nach kurzem Aufstieg
konnten wir bei einbrechender Dunkelheit in den Feuerschlund blicken, ein
nachhaltig beeindruckendes Erlebnis.
Ein 24-stuendiger Toern brachte uns dann nach Port Vila, der Hauptstadt von
Vanuatu. Hier empfing uns eine franzoesich gepraegte Atmosphaere, es gab
morgens frisches Baguette und die Speisekarten waren zur Abwechslung auch
erfreulich. Teile von Vanuatu waren waehrend der Kolonialzeit von Englaendern und
Franzosen gemeinsam verwaltet worden, daher der franzoesische Einfluss.
Dominierende Sprache ist jetzt jedoch Englisch.
In Port Vila kamen Nina und Jan aus Potsdam fuer vier Wochen zu uns. Nach
langer Zeit wurde es mal wieder tropisch warm. Wir konnten schlafen ohne uns
zuzudecken und genossen die wohlige Waerme.
In den Wochen oder sogar Monaten zuvor war immer viel kuehle Luft aus dem
Suedmeer in die Tropen vorgedrungen und hatte vielfach bedecktes Wetter bei
nur 23° bis 25° oder 27 ° gebracht. Nachts musste man sich mit einem leichten
Frotteetuch zudecken.
Von den Inseln Vanuatus hatten wir gehoert, dass sie noch recht abgeschieden
und urspruenglich sein sollten. Ausser Seglern kommen kaum Touristen in die
Inselwelt. Die Inseln sind alle vulkanischen Ursprungs, insgesamt sind noch
neun Vulkane aktiv, davon zwei unter Wasser. Die Inselkette liegt direkt auf
dem pazifischen Feuerring, der die Grenze zwischen der pazifischen und
australichen Platte bildet. Vanuatu liegt zu beiden Seiten, so dass einige Inseln
jaehrlich um 2cm gehoben werden, andere im Meer versinken. Das letzte grosse
Erdbeben mit grossen Schaeden (ueber sieben auf der Richterskala) ereignete
sich 1994. Die Inseln sind hoch, sehr zerklueftet und mit ueppiger tropischer
Vegetation bedeckt. 1969 soll zum letzten Mal Menschenfleisch verzehrt worden
sein. Wir errechneten uns daher gute Ueberlebenschancen.
Bevor wir Port Vila verliessen, musste die Stella mit allen notwendigen
Lebensmitteln ausgeruestet werden. Denn unterwegs konnten wir nur auf ein wenig
frisches Gemuese und eventuell auf einige Fruechte der Saison hoffen. Diese
wurden von Einheimischen mit ihren Einbaeumen direkt an das Boot gebracht und
gegen gebrauchte Kinderkleidung getauscht, fuer die grosser Bedarf besteht.
Die Kleidung hatten wir in Australien in einem second-hand-shop vorsorglich
gekauft.
Auf einem der naechsten Ankerplaetze (Bannam Bay, Malekula) boten uns die
Bewohner eines Dorfes gegen angemessene Bezahlung an, ihre traditionellen
Taenze aufzufuehren. Es war schon spaet am Nachmittag, als wir uns dafuer
entschieden. Eine Stunde Vorbereitungszeit genuegte, um ca 20 maennliche und
ebensoviele weibliche Taenzer und Taenzerinnen vorzubereiten. Trotzdem wurde es bald
dunkel und der Tanzplatz wurde mit brennenden Zweigen von Kokospalmen
beleuchtet. Die Maenner tanzten mit weisser Farbe bemalt und nur mit Peniskoecher,
die Frauen nur mit Roecken aus Pandanusstreifen bekleidet.
Diese Taenze wurden fuer uns zu einem ganz besonderen Erlebnis.
Unser nordlichster Punkt (Asanwari auf Maewo) wurde zu einem weiteren
besonderen Erlebnis.
Dieses Dorf bietet bei ausreichender Beteiligung fuer Segler ein gemeinsames
Abendessen und anschliessend traditionelle Taenze und Gesaenge. Als wir
ankamen, waren im Dorf kaum noch Bewohner. Die meisten Dorfbewohner waren von
Seglern in ein ca 7 sm noerdlich gelegenes Dorf zu einem Fest gefahren worden.
Wir fuhren ebenfalls dorthin. Beide Doerfer sind nicht durch eine Strasse oder
einen Weg verbunden. Zwischen beiden Orten liegen hohe, zerklueftete Berge,
die total unwegsam sind. Die Verbindung zwischen den Doerfern kann nur mit
einem kleinen Boot (hoechstens 10 Passagiere oder mit Auslegerkanus aufrecht
erhalten werden. Der Transport mit unserem Segelbooten kam also sehr gelegen.
Zum Dorffest hatten sich Bewohner aus 6 Doerfern getroffen. Im Mittelpunkt
der Veranstaltung stand ein Volleyballturnier und zwar mit Maenner- und
Frauenmannschaften. Ausserdem gab es einen Wettbewerb fuer Stringbands und fuer
Choere. Im Mittelpunkt der Stringband steht ein Bass, der aus einer Holzkiste
besteht, auf die ein ca 1 m langer Stock gestellt wird, mit dessen Hilfe ein
mit der Kiste verbundener Bindfaden gepannt wird. Eine Band trat mit einem
Keybord auf, ein hier ueberraschendes Instrument. Der auch vorgesehene Wettbewerb
von traditionellen Taenzen, entfiel fuer uns. Die Bewohner von Asanwari,
fuer deren Ruecktransport auch wir mit 14 Personen fest eingeplant waren,
mussten das Fest vorzeitig verlassen, weil sich auf dem Wasser von Norden ein
Squarerigger zeigte, dessen Chartergaeste als festen Programmpunkt das Essen und
die Taenze in Asanwari gebucht hatten. So traf sich dort am naechsten Abend
eine relativ grosse Gesellschaft im Dorfgemeinschaftshaus. Wir konnten
nochmals die beeindruckenden traditionellen Taenze sehen, die sich aber von denen
auf Malekula unterschieden.
Unsere Toerns hatten uns ca 150 sm nach Norden gebracht. In etwa 38 Stunden
segelten wir bei passendem NO-Wind zurueck nach Port Vila, versorgten das
Schiff nochmals und klarierten aus. (Zuvor kauften wir jedoch ca 50 Dosen mit
sehr leckeren franzoesischen Pasteten und Wurst, die wir in Australien bisher
nicht entdeckt hatten. Sie sind fuer die ca 3-monatige Ueberquerung des
indischen Ozeans (2004) bestimmt.) Da weiterhin passender Wind herrschte, liefen
wir aus und erreichten Noumea (Neukaledonien, ca 400 sm) in 4 Tagen.
Neukaledonien ist nicht vulkanischen Ursprungs sondern ein Teil des
Urkontinents Godwana. Es ist ungewoehnlich reich an Erzen. Eisen- und besonders
Nickelerze werden im Tagebau abgebaut und zum Teil auch im Lande verarbeitet. Es
gibt auch reiche Vorkommen an anderen edlen Metallen. Die Bevoelkerung, die
teils vom Erzbergbau und teils von Land- und Viehwirtschaft lebt, hat einen
guten Lebensstandard. Traditionelle Doerfer gibt es nicht mehr in Neukaledonien.
Die meisten wohnen in festen Stein- oder Holzhausern, und viele haben Autos.
Es gibt nur noch ein “Grande Case”, ein traditionelles Haus, das im
Wesentlichen der Schlichtung von Streitigkeiten unter den Dorfbewohnern und
zeremoniellen Handlungen dient.
In Noumea verliessen uns Nina und Jan und Peter kam fuer 3 Wochen an Bord.
Wir beschlossen, eine im Sueden liegende Insel (Iles des Pins) und eine der
Ostkueste vorgelagerte Inselgruppe (die Loyalties) zu besuchen, um dann an
der Ost- und Suedkueste der Hauptinsel zurueck nach Noumea zu segeln. Die
Iles Pins hat schoene Ankerbuchten und Straende und ist mit vielen Araukarien
(einer sehr urtuemlichen Nadelholzart) bewachsen, daher der Name “Insel der
Pinien”. Der Tourismus ist gut ausgebaut, es gibt sehr gute Strassen. Wir
mieteten also ein Auto und umrundeten in knapp 4 Stunden die Insel.
Ein 24-stuendiger Toern brachte uns nach Mare, der suedlichsten
Loyalty-Insel. Nach unserem ersten Besuch auf der Insel ging der Aussenborder kaputt (das
Kuehlsystem fiel aus) und Wolfgang gelang es nicht, ihn zu reparieren. Da
wir weit vor dem Ufer ankern mussten (wegen zahlreicher Korallenkoepfe)
verzichteten wir auf weitere Erkundungen und segelten an die Ostkueste der
Hauptinsel. Kurze Strecken konnten wir mit dem Aussenborder noch zuruecklegen.
Dieser Teil Neukaledoniens ist vom Erztagebau gepraegt. Die Landschaft sieht
total rot und gelb aus. In unserem ersten Hafen (Kouaoua) endet das
laengste, gekurvte Erztransportfoerderband der Welt. Es ist 13 km lang und fuehrt von
einer Tagebaustelle ueber viele Huegel zu einer Verladerampe am Hafen. Hier
koennen groessere Schiffe beladen werden.
In Kouaoua verschlechterte sich das Wetter drastisch und wir erlebten einen
windigen und total verregneten Tag mit Hoechsttemperaturen von 19°. Wir
fuehlten uns nach Hause in die Ostsee versetzt.
Peters Abreise rueckte naeher und wir wollten noch gemeinsam zwei Tage mit
einem Mietauto ueber die Insel fahren, also begannen wir gegen den
Suedostwind, der sogar bei dem schlechten Wetter fast aus Sued kam, loszukreuzen. Abends
suchten wir geschuetzte Ankerbuchten auf, da die niedrigen Temperaturen
nicht zum Durchsegeln verlockten und die Gegend nicht befeuert ist. Nach drei
Tagen hatten wir die Suedecke der Hauptinsel erreicht und wollten nun mit halbem
Wind nach Westen laufen. Jedoch drehte der Wind auf West und wurde teilweise
auch lebhaft. So benoetigten wir fuer die rund 40 sm bis Noumea noch zwei
weitere Tage. Zum Glueck gibt es dort ueberall kuschelige Ankerbuchten.
Die zweitaegige Autofahrt im suedlichen Teil der langen Hauptinsel erschloss
uns eine neue Welt. Die Kuesten sind stark gegliedert und haben viele
Ankerplaetze, aber das Inselinnere ist wild zerkluftet, und die gut ausgebauten
Strassen haben vielfach Hochgebirgscharakter. Die Insel ist, obwohl noch im
Tropenguertel liegend, teilweise subtropisch trocken, an der Ostkueste aber auch
ueppig tropisch gruen. Auf dieser Autofahrt besuchten wir – wie auch
Mitterand, Chirac und Le Penne – die letzte “Grande Case” der Insel.
Peter musste uns bald verlassen und fuer uns stand der Absprung nach
Australien vor der Tuer. Vier Tage wurden wir nach dem geplanten Auslauftermin noch
in Noumea festgehalten, weil der Wind mal wieder aus Suedwest wehte, genau
daher, wo wir hinwollten. Dann stellte sich aber wieder der Suedost-Passat ein
und wir hatten eine insgesamt ruhige Ueberfahrt. Wir brauchten fuer die ca
800 sm rund acht Tage, klarierten ein und verholten an unseren Liegeplatz in
Cleveland. Uns blieben noch 10 Tage bis zum Abflug nach Europa, in denen viel
zu regeln war. (Die Stella brauchte ganz dringend eine neue
Ueber-alles-Persenning, weil die alte morsch war. Ausserdem bestellten wir zwei neue Segel,
liessen das Auto ueberholen und kauften Ausruestung fuer unseren Australientoern
mit dem Auto (z.B. zweites Ersatzrad und Auftrag zur Beschaffung einer
gebrauchten extra Stossstange gegen Kaengurus.)
Mitte Januar 2004 wollen wir nach Australien zurueckkeheren, bis Ende Maerz
uns Australien ansehen, dann die Stella fuer den naechsten Toern fit machen.
Mitte Mai wollen wir beginnen, an der Ostkueste nach Norden zu segeln, um
Mitte Juli Darwin zu erreichen. Ende Juli soll dann Richtung Suedafrika
gestartet werden, wo wir Ende Oktober in Richards bay oder Durban ankommen wollen,
von Brisbane aus etwa 7.000 sm
Ingeborg Voss und Wolfgang Dinse.